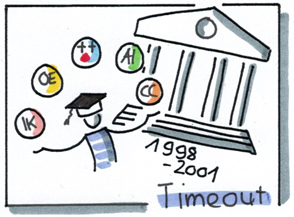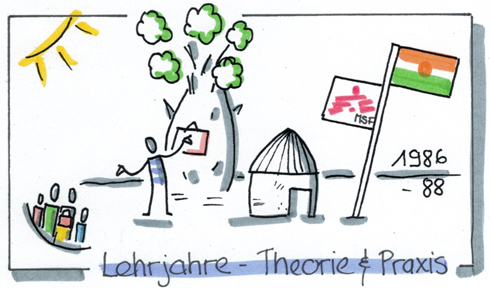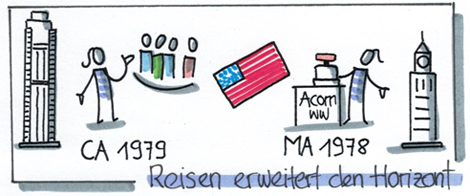Steck Menschen nicht in Schubladen
«Tief drin, Ariane, fühlst du dich als West- oder Deutschschweizerin?» Alle, die eine zweisprachige oder «Drittkulturkind»-Erziehung genossen, haben diese Art von Frage schon einmal gehört.
Ich bin Schweizerin. Eine Westschweizerin, geboren und aufgewachsen in Basel, in der Deutschschweiz. Zu Hause sprachen wir ausschliesslich Französisch, mit Mitschülern und Freunden den lokalen Schweizerdialekt Baseldytsch und in der Schule Standard- bzw. «Hochdeutsch». Später studierte ich sechs Jahre in Deutschland, lebte zwei Jahre in Niger, einem französischsprachigen afrikanischen Land, liess mich dann in Genf nieder, während ich weiterhin für die Arbeit durch die Welt reiste. Daher kann man mich wohl kaum in eine einzige Schublade stecken.
Wir sind eigentlich alle viel zu komplex, als dass man sich einen Stempel aufdrücken lassen sollte.
Wenn man Menschen in Schubladen steckt, besteht das Problem darin, dass diese oft mit Vorurteilen verbunden sind. Während meiner Schulzeit gab mir mein Deutschlehrer aufgrund meines Stempels «Westschweizerin» sehr lange Zeit schlechte Noten in Deutsch. Eines Tages gelang es mir, ihm das Gegenteil zu beweisen, indem ich meine Hausaufgaben mit denen meiner besten Freundin tauschte. Sie bekam für meine Hausaufgaben eine bessere Note als ich für ihre. Ebenso wurde ich, als ich mich in der Westschweiz niederliess, einmal von einem Westschweizer Kollegen beschuldigt, in Wahrheit eine Deutschschweizerin zu sein, die sich nur hinter der Fassade einer Westschweizerin verstecke.
Ich bin Schweizerin. Eine Westschweizerin, die in der Deutschschweiz geboren und aufgewachsen ist. Das ist meine Identität. Punkt. Aber wie Amartya Sen es ausdrückt: «Die Herausforderung besteht darin, die Welt davon zu überzeugen, uns so zu sehen, wie wir uns selbst sehen.»
Identität, Diskriminierung, Gewalt … und Hoffnung
Mein Vater, der Sportjournalist war, kaufte 1968 unseren ersten Schwarzweissfernseher, um die Olympischen Spiele in Mexiko zu schauen. Eben in jenem Jahr fernzusehen, rüttelte mich aus meiner kindlichen Fantasiewelt. Zwei Bilder prägten mich für immer:
1) Tommie Smith und John Carlos, zwei afroamerikanische Athleten, streckten während ihrer Medaillenverleihung in Mexiko die Hand zum «Human Rights»-Gruss, um gegen Rassendiskriminierung in den USA zu protestieren.
2) Die Bilder von hungernden Kindern in Biafra. Der Biafra-Krieg Nigerias war einer der blutigsten Unabhängigkeitskriege, der je in Afrika geführt wurde: Mehr als 1 Million biafranische Zivilisten starben durch Gewalt und Hunger.
Vor den Olympischen Spielen reisten wir mit der ganzen Familie in die USA, damit mein Vater einige amerikanische Athleten in mehreren Trainingslagern an der Westküste interviewen konnte. Wir hielten in Eugene, Oregon. Die Stadt war zufällig eine der Hochburgen der Hippie-Bewegung. Dort war ich einem der vielen Anti-Kriegsmarschveranstaltungen ausgesetzt. «Make love, not war.» Ich war damals noch ein sehr kleines Kind, aber diese Erfahrungen hatten einen grossen Einfluss auf mein Leben und meine beruflichen Entscheidungen als Erwachsene.
Steh auf eigenen Füssen
In der Schweiz wird Unabhängigkeit allgemein geschätzt und gefördert. Von der Wiege an wird den Kindern beigebracht, selbstständig zu werden und sich auf sich selbst zu verlassen – zum Beispiel allein zu Fuss in den Kindergarten und die Primarschule zu gehen – anstatt sich auf andere zu verlassen.
Ich war eine leidenschaftliche Schlittschuhläuferin. Aber im Sommer wurde die Freiluftschlittschuhbahn meiner Heimatstadt zu einem Tennisplatz. Im Alter von zehn und elf Jahren schickten mich meine Eltern in den Sommerferien ganz allein nach La Chaux-de-Fonds, um in einer gedeckten Schlittschuhbahn zu üben. Ich wohnte in einer Jugendherberge, kümmerte mich um meine Lebensmitteleinkäufe, bereitete mein Essen auf einem Campingkocher zu und verpasste kein einziges meiner täglichen Schlittschuhtrainings. Einmal in der Woche, am Sonntag, rief ich meine Eltern aus einer Telefonkabine an, um sie wissen zu lassen, dass es mir gut ging. Dies führte dazu, dass Unabhängigkeit auf meiner Werteskala ganz oben steht. Ich kann meinen Eltern gar nicht genug dafür danken, dass sie mich zu dieser Tugend erzogen haben, auch wenn einige Leute denken mögen, dass sie dabei unverantwortlich waren. Andere bemitleiden mich sogar, weil sie glauben, ich hätte mich dabei einsam gefühlt, die Dinge allein zu bewältigen.
Reisen erweitert den Horizont
Als Teenager arbeitete ich zunächst einen Sommer lang auf einem Pferdehof in Gloucester, England, und verbrachte dann zwei Sommer in den USA.
Ostküste: Ich ging als «Au-pair-Mädchen» nach Cambridge, Boston. Glücklicherweise hatte die Familie, bei der ich wohnte, (noch) keine Kinder. Morgens half ich der Familie in ihrem kleinen Tischlereigeschäft, und nachmittags genoss ich die «Joy of Movement», also die Freude an der Bewegung, in einer nahegelegenen Tanzschule gleichen Namens. Ich kehrte fitter denn je nach Hause zurück, obwohl ich einige (eher kalorienreiche) neue Lebensmittel entdeckt hatte (wie mein erstes regionales Frühstück: ein Erdnussbutter-, Bananen-, Honig- und Marshmallow-Crème-Sandwich). Insgesamt war diese Lebenserfahrung, bei der einzigen «weissen Familie» in einer «afroamerikanischen» Nachbarschaft zu leben, eine Bereicherung.
Westküste: Ich ging zu meinem Onkel, der Universitätsprofessor in Los Angeles, Kalifornien war. Schüler aus der ganzen Welt strömten herbei, um in seinem Team zu arbeiten. So entdeckte ich noch vor Beginn der globalen Ära eine «globale Welt» und genoss jede Minute, die ich mit seiner Gruppe internationaler Studenten verbrachte. Dabei überwand ich auch einige Stereotypen, die damals in meinem Kopf herumschwirrten. Es war die Zeit des Kalten Krieges, und es dauerte einige Zeit, bis ich mich auf die russischen Studenten eingestellt hatte. Ich lernte jedoch die Kraft echter Neugierde kennen und erfuhr, dass es sich lohnt, auf die Dinge zu achten, die man mit anderen gemeinsam hat – anstatt auf die Dinge, die uns voneinander trennen.
Minimale Differenzen – Maximale Störungen
Dank meiner Mutter, die lange vor dem Aufkommen von Internet und Social Media eine geschickte Netzwerkerin war, fanden wir in Deutschland eine Universität, die meinen beruflichen Vorstellungen entsprach. Ich habe an der Justus-Liebig-Universität (JLU) «Ernährungs- und Wirtschaftssicherheit» mit Schwerpunkt Entwicklungsländer studiert. Es handelt sich dabei um ein äusserst interdisziplinäres Studienfach, das Fachgebiete wie Wirtschaft, Volkswirtschaftslehre, Statistik, Anthropologie und Landwirtschaft sowie Biologie, Chemie, Biochemie, Gesundheitswesen und Ernährungsphysiologie umfasst.
Bei der Ankunft erlebte ich jedoch meinen ersten echten «Kulturschock». Ich hatte fälschlicherweise angenommen, dass, wenn ich nur dreieinhalb Stunden Autofahrt von meiner Heimatstadt entfernt bin und dieselbe Sprache (Deutsch) spreche, die Dinge nicht SO anders sein würden, als ich es gewohnt war. Aber selbst minimale Differenzen führen zu maximalen Störungen: Kommunikations- und Argumentationsstile, die Einstellung zu Hierarchien, sogar Ernährungsgewohnheiten und Höflichkeitsformen, nichts war wirklich so wie in der Schweiz. Wenn man zwischen Kontinenten wechselt, erwartet man, dass Dinge anders sein werden, und man ist darauf vorbereitet. Doch nicht, wenn man in ein Nachbarland reist. Und erst recht nicht, wenn man dieselbe Sprache wie dort spricht. Die unerwartete Natur dieser teilweise kleinen, aber sehr realen Unterschiede kann zu Verwirrung und Unglauben führen.
Lehrjahre – von der Theorie zur Praxis
Sich nach sechs Jahren Universität als «Profi» zu betrachten, erweist sich – sobald man in der realen Welt angekommen ist – als Illusion.
Guidan Sori, Niger, Westafrika: Ich arbeitete als Freiwillige für „Ärzte ohne Grenzen“ (MSF) in der Sahelzone, und lebte als einzige weisse Frau in einem Dorf mit 25 Familien (durchschnittliche Familiengrösse: 8,5 Personen). Die Dorfgemeinde schlug sich durch, indem sie Erdnüsse für den Handel, und Hirse, Sorghum und Kuhbohnen zur Selbstversorgung anbaute. Niederschläge gab es kaum bis gar nicht, weshalb die Ausbeute der landwirtschaftlichen Erzeugnisse unvorhersehbar war.
Meine Aufgabe war es, unterernährte Kinder zu untersuchen und zu behandeln und Müttern beizubringen, wie sie ihre Kinder besser ernähren können. Ziel war es, die hohe Unterernährungsrate in der Region zu senken. Ich erkannte schnell, dass ich als junge, unverheiratete, kinderlose und alleinstehende Frau den Menschen, denen ich half, nicht sehr glaubwürdig erschien – zumindest am Anfang. Später erkannte ich, dass es die Männer waren, auf die ich mich konzentrieren musste, da sie diejenigen waren, die über die finanziellen Ausgaben entschieden. Am Ende meines Aufenthalts hatte sich mein Augenmerk ganz auf landwirtschaftliche und wirtschaftliche Programme verlagert, mit denen sich Einkommensquellen schaffen und somit auch eine bessere Ernährung sicherstellen liess.
Das Wichtigste, was ich aus meinen Erfahrungen in Nigeria gelernt habe: Man sollte nie glauben, man sei ein «Experte». Oder wie Amadou Hampâté Bâ (malischer Schriftsteller und Ethnologe) es formulierte: «Man muss wissen, dass man es nicht weiss. Wenn du weisst, dass du es nicht weisst, dann wirst du es wissen. Aber wenn du nicht weisst, dass du es nicht weisst, dann wirst du es niemals wissen.»
Humanitäre Jahre
Ich werde meinen ersten Einsatz für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) im Jahr 1988 nie vergessen: Ich sass in einem Flugzeug der «Ariana Afghan Airlines», und wir näherten uns in einer sehr steilen, schnellen und extrem engen Spiralbewegung dem Kabul Airport (Afghanistan), während wir von Militärflugzeugen umgeben waren, die Infrarot-Täuschraketen abfeuerten, um nicht von Raketen getroffen zu werden. Willkommen in der humanitären Arbeit! Mehr als fünfzig weitere Einsätze folgten in Dutzenden von Konfliktgebieten in Afrika, Asien, Zentralasien, im Nahen Osten, im Kaukasus und im Balkan. Ich werde mich auch immer an meinen letzten IKRK-Einsatz erinnern – meine 15. Reise nach Afghanistan, auf der ich die Aufgabe hatte, einige abgelegene Dörfer in einer der bergigsten Regionen Afghanistans zu Pferd zu erkunden. Es fühlte sich an, als hätte sich der Kreis geschlossen.
Beruflich führte ich im Auftrag des Economic Security Department (Wirtschaftliche Sicherheit) des IKRK Bewertungen des wirtschaftlichen Sicherheitsstatus der Bevölkerungsgruppen, Regionen sowie öffentlichen Institutionen durch. Ich war mit Bedarfsanalysen und Programmbewertungen sowie der strategischen Planung, dem Projektmanagement und der Projektumsetzung betraut. Ich musste mit lokalen Behörden und anderen humanitären Organisationen verhandeln und mich mit ihnen abstimmen sowie verschiedene Schulungen für IKRK-Mitarbeiter und Universitäten auf vier Kontinenten konzipieren und durchführen.
Persönlich haben mich meine Jahre in der humanitären Arbeit Demut und Dankbarkeit dafür gelehrt, dass ich in einer friedlichen und sicheren Umgebung aufwachsen durfte. Diese Zeit hat mir beigebracht, die Dinge aus einer breiteren Perspektive zu betrachten und zu versuchen, mich in andere Menschen hineinzuversetzen – auch wenn dies eine Herausforderung war. Mir wurde klar, dass die Dinge nie einfach nur schwarz oder weiss sind, sondern dass es viele Grautöne gibt. Dies liess mich meine Annahmen in Frage stellen, über den Tellerrand schauen und meine eigenen massgeschneiderten/kreativen, nicht universell gültigen Lösungen entwickeln. Schliesslich erkannte ich, dass Menschen, die fast nichts besitzen, manchmal die fürsorglichsten und grosszügigsten von allen sind, und man nicht unbedingt reich sein muss, um glücklich zu sein.
Timeout – Eindrücke werden zu Erkenntnissen
Um meine Managementfähigkeiten als neue Leiterin der Abteilung Wirtschaftliche Sicherheit des IKRK weiterzuentwickeln, begann ich einen Executive Master in Management und Organisationsentwicklung (MOE). Während dieses Studiums schlugen mir zwei meiner Professoren nachdrücklich und beharrlich immer wieder vor, meine internationale Erfahrung in interkulturelle Kompetenz zu übertragen. «Du reist seit Jahren um die Welt. Geh noch mal an die Universität und nimm dir etwas Zeit, um deine Erfahrungen zu strukturieren». Nach einigem Zögern gab ich schliesslich nach und erwarb mehrere interkulturelle Zertifikate in Europa und den USA. Das einzige was ich bedauere: dass ich so lange damit gewartet habe, «meine Eindrücke in Erkenntnisse umzuwandeln», wie es der Reiseautor Pico Iyer ausdrückt.
Einige akademische Abschlüsse folgten (wie u. a. AI – Appreciative Inquiry, MBE – Manager in Business Entertainment, Process Consulting and Corporate Culture). Auch erfüllte ich mir meinen Kindheitstraum, Zirkuskurse an der Dimitri School in Verscio (im Tessin, dem italienischen Teil der Schweiz) zu besuchen. Danach war es an der Zeit, weiterzugehen und meine erworbenen Erfahrungen und Fähigkeiten in den Dienst von Einzelpersonen, Organisationen und Unternehmen zu stellen, die in einem zunehmend multikulturellen und komplexen Arbeitsumfeld arbeiten.
Menschen verbinden
Ctrl Culture Relations wurde 2001 in Lausanne als «Ein-Frau-Betrieb» mit einem grossen internationalen Netzwerk aus gleichgesinnten Fachleuten und Kollegen aus der ganzen Welt gegründet. Das Ziel des Unternehmens ist es, Einzelpersonen, Teams und Organisationen dabei zu unterstützen, in einer zunehmend vernetzten, komplexen und sich immer wieder verändernden Umgebung erfolgreiche Arbeit zu leisten. Zu den Kunden von Culture Relations gehören private Unternehmen und Gesellschaften, staatliche und nichtstaatliche Organisationen, kleine Unternehmen mit internationalen Partnern, fusionierte Unternehmen, internationale humanitäre Organisationen sowie Universitäten und die Welt der Wissenschaft.
Ein wesentlicher Aspekt meiner Arbeit besteht – vereinfacht gesagt – darin, Menschen zusammenzubringen. Menschen mit sich selbst, mit anderen und mit ihrer Umwelt zu verbinden, um die individuelle Leistung, die Leistung von Gruppen und den geschäftlichen Erfolg zu verbessern. Ich setze mich dafür ein, die Bedürfnisse und Erwartungen meiner Kunden zu erfüllen oder zu übertreffen. Ich folge meinem Herzen und meiner Intuition, um meine Aufgaben auf sehr partizipative und kreative Weise zu erfüllen – das ist mir sehr wichtig. Ich bin für meine Leidenschaft, Begeisterung und Dynamik und für meine Motivation, neue Bereiche für meine Kunden zu erschliessen, bekannt.